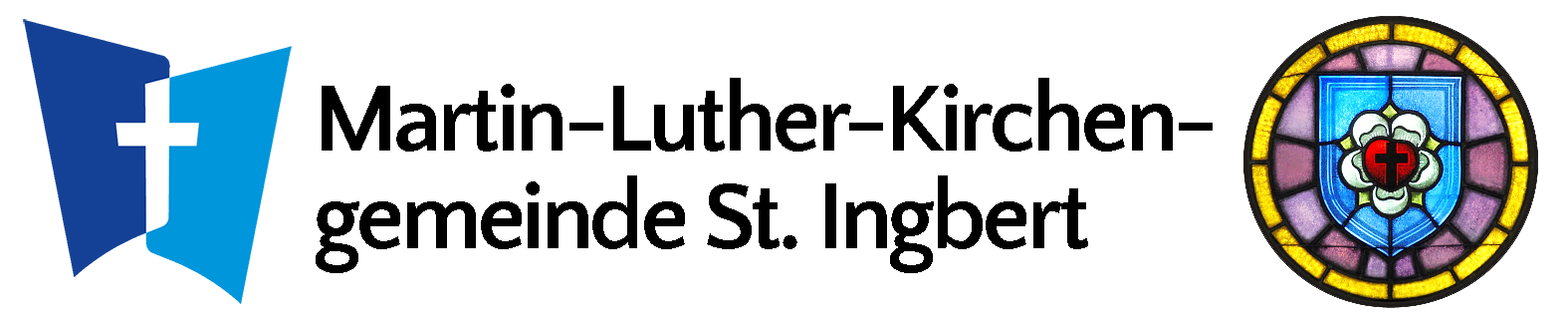An dieser Stelle beginnen wir mit einer kleinen Serie, die den Leserinnen und Lesern unserer Internetseiten theologisches Grundwissen vermittelt. Wir folgen dabei der liturgischen Struktur des Kirchenjahres. Die Texte stammen aus der Feder des namhaften Rostocker Liturgiewissenschaftlers Prof. Karl-Heinrich Bieritz.
In den ersten drei Jahrhunderten kannte die Christenheit außer dem Osterfest keine Jahresfeste. Erst im 4. Jh. begann man in Rom, den 25. Dezember als Geburtsfest Christi zu feiern. Etwas früher setzte sich im Osten und in manchen Gebieten des Abendlandes der 6. Januar als Fest der Erscheinung Christi (Epiphanie; Genitiv Epiphanias) durch. Über den Ursprung des römischen Weihnachtsfestes gibt es unterschiedliche Hypothesen. Manche gehen davon aus, dass christliche Theologen durch Berechnungen verschiedenster Art auf den 25. Dezember als Geburtsdatum Jesu gekommen sind. Andere meinen, dass das Geburtsfest Jesu mit dem Fest des unbesiegten Sonnengottes (Natale Solis Invicti) zusammenhängt, das der römische Kaiser Aurelian im Jahre 274 eingeführt und in die Nähe der Wintersonnenwende auf den 25. Dezember gelegt hatte. Vermutlich haben beide Faktoren-Versuche, das Geburtsdatum Jesu zu berechnen, und die Verchristlichung des Sonnenfestes - bei der Entstehung und raschen Ausbreitung des Festes zusammengewirkt. In den Kirchen des Ostens tritt es seit dem Ende des 4. Jh. dem Epiphaniasfest zur Seite mit Ausnahme der armenischen Kirche, die bis heute die Geburt Jesu nicht am 25. Dezember, sondern nur am 6. Januar feiert.
Geburtstag oder Geburtsfest meinte in der Sprache der Antike mehr als die bloße Erinnerung an die Geburt eines Menschen. Der Ausdruck konnte- zumal da, wo er auf Herrscher und Götter Anwendung fand - auch die Bedeutung von Machtentfaltung, Verherrlichung, Offenbarung, Vergöttlichung in sich aufnehmen. Man darf annehmen, dass die Christen das Fest von Anfang an in solch weiterem Sinne und nicht nur als Gedächtnistag des historischen Ereignisses der Geburt Jesu begangen haben: Sie feiern die Offenbarung Gottes in Jesus Christus, sein Kommen in die Welt in Gestalt eines von einer Frau geborenen, Leid, Vergänglichkeit und Tod unterworfenen Menschen. Sie feiern zugleich solche Selbstentäußerung und -erniedrigung Gottes als Erweis und Bestätigung seiner göttlichen Macht.
Die Menschwerdung Gottes zielt auf die Erlösung der Menschen und der ganzen Schöpfung aus der Macht der Sünde und des Todes. Gott wurde Mensch, damit Menschen Kinder Gottes werden: Auf diese Formel hat christliche Theologie das weihnachtliche Festgeheimnis gebracht. Man spricht vom “wunderbaren Tausch”, der sich dabei vollzieht:”...in unser armes Fleisch und Blut verkleidet sich das ewig Gut”, heißt es bei Martin Luther (EG 23; vgl. auch EG 27). Gerade die sehr menschlichen Umstände der Geburt Jesu, von denen besonders Lukas berichtet, haben die fromme Phantasie immer wieder beschäftigt; gewinnt hier doch die abstrakte Rede von der Menschwerdung Gottes konkrete Gestalt. Die Faszination, die bis heute für viele Menschen von Weihnachten ausgeht, hängt damit zusammen: Es sind durchaus vorstellbare, erfahrbare, alltägliche Gegebenheiten und Geschehnisse, von denen da die Rede ist.
Von Beginn an ist dem Weihnachtsfest die Lichtthematik eigen: Die Menschwerdung Gottes wird ins Bild gesetzt durch das Gleichnis vom Licht, das in die Welt kommt (Joh 1,4f.7.9; 3,19ff.; 8,12; 9,5 u. ö.) und die Finsternis vertreibt: »Das ewig Licht geht da herein, gibt der Welt ein' neuen Schein« (EG 23). Als Christusfest kommt Weihnachten, von der Christvesper am Heiligen Abend bis zum Epiphaniasfest am 6. Januar, die weiße Farbe zu.
Vermutlich unter dem Einfluss ostkirchlicher Praxis wurde seit dem 6. Jh. in Rom der vorösterlichen Fastenzeit eine Vorfastenzeit vorangestellt, die mit dem Sonntag Septuagesimae (von lat. siebzig; genau genommen, ist es der 63. Tag vor Ostern) begann. Auch andere Einflüsse - die Vorbereitung auf die österliche Taufe, eine verstärkte Bußgesinnung angesichts der unsicheren Weltlage - mögen dabei eine Rolle gespielt haben. Während man im Zuge der nachkonziliaren Kalenderreform in der katholischen Kirche die Vorfastenzeit abgeschafft hat, hält das Evangelische Gottesdienstbuch der Sache nach an ihr fest, auch wenn die Sonntage hier als Sonntage vor der Passionszeit bezeichnet und gezählt werden. Die liturgische Farbe ist grün.
Seit dem 4. Jh. ist eine vierzigtägige Vorbereitungszeit (lat. Quadragesima) auf das Osterfest bezeugt.
Im evangelischen Bereich heißen die Vierzig Tage Passionszeit - Zeichen dafür, dass das Motiv der Passion Jesu die gesamte Vorbereitungszeit auf Ostern bestimmt. Ursprünglich war solche Prägung auf die Karwoche beschränkt. Im Mittelalter dehnte man die Passionszeit auf die beiden Wochen vor dem Osterfest aus. Der 5. Sonntag vor Ostern, Judika, wurde als Passionssonntag begangen. Im Anschluss an die Leseordnung von 1978 bezeichnet das Evangelische Gottesdienstbuch die gesamte Quadragesima als Passionszeit. Sie beginnt am Aschermittwoch.
Den biblischen Hintergrund für die Begehung der Vierzig Tage liefern all jene Texte, in denen dem Zeitraum von 40 Tagen bzw. 40 Jahren eine besondere Bedeutung zukommt (vgl. zum Beispiel 1 Mose 7,4ff.; 2 Mose 24,18; 34,28; 1 Kön 19,8; Jos 5,6; Jona 3,4; Mk 1,13; Mt 4,2; Lk 4,1f). Es sind allemal Zeiten des Übergangs, der Vorbereitung und der Läuterung, von denen hier berichtet wird. In der alten Kirche traten die Taufbewerber, die Katechumenen, mit dem Beginn der Vierzig Tage in ein neues Stadium ihrer Taufvorbereitung ein. Als Photizomenen (griech. "die erleuchtet werden") bereiteten sie sich intensiv auf ihre Taufe in der Osternacht vor. Die liturgische Begehung der Quadragesima wurde hiervon stark geprägt. Die liturgische Farbe der Passionszeit ist violett.
Die frühchristliche Osterfeier zeichnete sich dadurch aus, dass hier Leiden, Tod und Erhöhung Christi als Einheit erfahren und gefeiert wurden. Ostern war nicht einfach das ›Fest der Auferstehung Jesu‹, sondern hatte das Geheimnis der Erlösung insgesamt zum Thema. Die Passion Jesu und sein Tod am Kreuz waren noch nicht einem — historisch wie gottesdienstlich von Ostern getrennten — ›Karfreitag‹ zugeordnet, sondern bildeten zusammen mit dem Gedächtnis seiner Auferstehung den unteilbaren Inhalt der Osterfeier selbst.
Vom 4. Jh. an wird — zuerst in Jerusalem — die Tendenz wirksam, in der österlichen Festfeier die Christusgeschichte sozusagen historisch nachzuvollziehen. In einem ersten Schritt kam es zur Ausgliederung der heiligen drei Tage (Triduum sacrum): Karfreitag als Tag des Leidens und Sterbens Jesu; Karsamstag als Tag der Grabesruhe; Ostersonntag als Tag seiner Auferstehung. Da der Vorabend bereits den folgenden Tag eröffnete, begannen die heiligen drei Tage faktisch mit dem Donnerstagabend. Im Zentrum der Feier stand weiterhin der Gottesdienst in der Osternacht, mit dem der dritte Tag des Triduum sacrum eröffnet wurde.
Bald wurde die ganze Woche vor Ostern als Heilige Woche (Große Woche, Leidenswoche, Karwoche — von althochdeutsch kara = Trauer, Klage) begangen.
Palmsonntag
Ein Eselskönig: Jesus — als König begrüßt — hält auf einem Eselsfüllen Einzug in Jerusalem. »Das verstanden seine Jünger zuerst nicht«, heißt es im Evangelium (Joh 12,12-19). Haben wir es wirklich verstanden? Das große Christuslied in Phil 2,5-11, als Epistel gelesen, versucht eine Auslegung. Es beschreibt den ›Königsweg‹ des Gottessohnes, der durch die tiefste Erniedrigung zur Verherrlichung führt. Eine Prozession am Palmsonntag zur Erinnerung an den Einzug Jesu in Jerusalem ist zuerst in Jerusalem bezeugt. Der Brauch verbreitete sich seit dem 8. Jh. auch im Abendland. Man führte grünende Zweige mit sich, die zuvor gesegnet wurden. In der katholischen Kirche eröffnen Palmsegnung und -prozession auch heute noch die Feier der Heiligen Woche.
Gründonnerstag
Das tut zu meinem Gedächtnis: »In der Nacht, da er verraten ward« (1 Kor 11,23) erinnert sich die Christenheit daran, dass sie nicht zuerst als eine »Interpretations- und Argumentationsgemeinschaft« (Johann Baptist Metz), sondern als eine Mahl- und Tischgemeinschaft in die Geschichte eingetreten ist. Bis heute steht — wenn auch in den Kirchen auf unterschiedliche Weise umgeformt, verdunkelt, manchmal auch vergessen — eine Mahlhandlung im Zentrum des christlichen Gottesdienstes, die in der Praxis Jesu selbst wurzelt. Am Vorabend seines Todes begeht die Christenheit das Gedächtnis der Einsetzung des heiligen Abendmahls.
Die eigentliche ›Festgeschichte‹ steht darum diesmal in der Epistel 1 Kor 11,23-26, dem wohl historisch ältesten Mahlbericht. Die alttestamentliche Lesung 2 Mose 12,1.3-4.6-7.11-14 vergegenwärtigt — indem sie von der Einsetzung des Passafestes erzählt — die israelitisch-jüdischen Wurzeln des Herrenmahls.
Der Gottesdienst am Gründonnerstagabend eröffnet den inneren Kern der Osterfeier, die Drei österlichen Tage vom Leiden, vom Tod und von der Auferstehung des Herrn (Triduum sacrum). Die liturgische Farbe ist weiß.
Die Bezeichnung Gründonnerstag leitet sich vermutlich von einem mittelhochdeutschen Verb gronan = weinen, greinen ab. Sie verweist darauf, dass ursprünglich an diesem Tage die öffentlichen Büßer (›Weinende‹) wieder in die volle kirchliche Gemeinschaft aufgenommen wurden und am Abendmahl teilnehmen durften.
Karfreitag
Man liest als Evangelium einen Auszug aus der Passionsgeschichte nach Johannes (Joh 19,16-30; früher konnte hier die ganze Passion gelesen werden), als alttestamentliche Lesung das Lied vom stellvertretenden Leiden des Gottesknechtes nach Jesaja ([52,13-15]53,1-12) und die Epistel aus 2 Kor 5,(14b-18)19-21 von der Selbstversöhnung des Schöpfers mit seiner Schöpfung in Christus.
In den ersten christlichen Jahrhunderten wurde der Karfreitag nicht gottesdienstlich begangen. Wohl aber ist der Brauch bezeugt, am Karfreitag und Karsamstag zum Gedenken an den Tod und die Grabesruhe Jesu zu fasten. Im 4. Jh. verehrte man in Jerusalem am Karfreitag das heilige Kreuz und hielt einen Wortgottesdienst zur Todesstunde Jesu. Die katholische Kirche kennt bis heute keine Eucharistiefeier am Karfreitag, sondern lädt zur »Feier vom Leiden und Sterben Christi« am Nachmittag ein, die Wortgottesdienst — mit den großen Karfreitagsfürbitten -, Kreuzverehrung und Kommunion miteinander verbindet.
In der Frömmigkeit evangelischer Christen kommt dem Karfreitag ein besonderer Rang zu. Er gilt vielfach als höchster Feiertag des Kirchenjahres und als einer der wichtigsten Abendmahlstage. Die liturgische Farbe ist schwarz oder violett. Es kann aber auch auf jegliche Farbe verzichtet werden. Der Altar kann ohne Kerzen, Blumen und anderen Schmuck bleiben.
Karsamstag
Karsamstag gilt als Tag der Grabesruhe Jesu. Als alttestamentliche Lesung Ez 37,1-14 liest man die große Vision des Propheten von der Auferweckung des Totenfeldes durch den Odem Gottes. Die Epistel 1 Petr 3,18-22 enthält den — später auf die ›Höllenfahrt Christi‹ gedeuteten — Hinweis, dass Christus auch den »Geistern im Gefängnis« gepredigt habe. Das Evangelium Mt 27,(57-61)62-66 erzählt von der Grablegung Jesu durch Josef aus Arimathäa und von der Anordnung des Pilatus, das Grab bewachen zu lassen.
Osternacht
Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden: Dreimal wird der Ruf wiederholt, dreimal antwortet die Gemeinde darauf mit dem Halleluja. Alle singen »Christ ist erstanden« (EG 99), und feierlich wird das Auferstehungsevangelium (Mt 28,1-10) vorgetragen: »Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach...« Doch bevor es soweit ist, ist noch ein weiter Weg zurückzulegen: Der Gottesdienst in der Osternacht beginnt mit der Lichtfeier. Wo es möglich ist, wird die Osterkerze am Osterfeuer entzündet, das vor dem Portal der Kirche brennt. Die Osterkerze wird in die dunkle Kirche getragen, und dreimal erklingt das Lumen Christi: »Christus, Licht der Welt — Gott sei ewig Dank«. Alle entzünden ihre Kerzen am großen Osterlicht und es erklingt der Österliche Lobpreis. Dann läuten die Glocken, die Kerzen am Altar werden entzündet, die Orgel erklingt, und die Gemeinde singt das große Gotteslob.
Der Gottesdienst in der Osternacht galt in der frühen Kirche als der bedeutendste des ganzen Jahres und als Herzmitte christlicher Festfeier überhaupt. Er begann mit einer gemeinsamen Nachtwache, die noch ganz von der Trauer über Leiden und Tod Jesu bestimmt war, und dauerte bis zum frühen Morgen, wo er unter Freude und Jubel mit der Feier des Abendmahls abgeschlossen wurde.
Die österliche Freudenzeit
Mit der Feier der Osternacht beginnt die Österliche Freudenzeit. Sie dauert fünfzig Tage (griechisch: Pentekoste; lateinisch: Quinquagesima) und endet mit dem Pfingstsonntag, dem ›fünfzigsten Tag‹ nach Ostern. Die ganze Zeit galt in der frühen Kirche gleichsam als ein einziger, ungeteilter Festtag, inhaltlich bestimmt durch das österliche Geheimnis des Hinübergangs Jesu — und mit ihm der Christen — durch den Tod in das Leben. Seit dem Ende des 4. Jh. steht der ›fünfzigste Tag‹ im Zeichen der Ausgießung des Heiligen Geistes — als Erfüllung und Besiegelung der österlichen Ereignisse.
Besondere Bedeutung besitzt in der frühen Kirche die Woche nach Ostern (Osteroktav, Weiße Woche), in der Gottesdienste und Predigten (Katechesen) für die Neugetauften gehalten werden.
Die liturgische Farbe der Osterzeit ist weiß. Während der Gottesdienste brennt die Osterkerze, die früher vielfach bereits nach dem Evangelium des Himmelfahrtstages gelöscht wurde.
Erhöhung des Herrn
Erhöht von der Erde: Die Botschaft des Himmelfahrtsfestes spricht von Abschied, aber auch von Nähe - Jesus trennt sich vom engen Kreis der Jünger, um an der Seite Gottes allen Menschen nahe zu sein. Epistel (Apg 1,3-4[5-7]8-11) und Evangelium (Lk 24,[44-49]50-53) erzählen die Geschichte von der Himmelfahrt Jesu, wobei die unterschiedlichen Nuancen aufmerksam zur Kenntnis zu nehmen sind. In der frühen Kirche war das Gedächtnis der Himmelfahrt Christi zunächst eng mit der Osterfeier verbunden. Erst im 4. Jh. - ein frühes Zeugnis hierfür ist eine Predigt des Bischofs Chrysostomus von Jerusalem aus dem Jahre 386 - begann man damit, den 40. Tag nach Ostern entsprechend der Zeitangabe des Lukas als Tag der Himmelfahrt Christi zu begehen.
Tag der Ausgießung des Heiligen Geistes
Und als der Pfingsttag gekommen war: Zu jedem Fest gehört eine Festgeschichte. Diesmal ist es nicht das Evangelium, sondern die Epistel Apg 2,1-18, die diese Geschichte erzählt. Eine Geschichte voller Merkwürdigkeiten. Ein Brausen in der Luft und Feuerzungen zeigen das Kommen des Geistes an: Luft und Feuer, zwei der vier Elemente, sind im Spiel. Später kommt noch das Wasser dazu: Dreitausend lassen sich taufen (2,41). Wo bleibt das vierte Element, die Erde? Wird sie durch die ungezählten, unaussprechlichen Weltgegenden repräsentiert, die in dieser Geschichte aufgerufen werden (2,9-11)? Ebenso groß wie unbestimmt und unbestimmbar klingt dagegen das Evangelium auf den Pfingsttag (Joh 14,23-27): Der Tröster, der heilige Geist, »der wird euch alles lehren und an alles erinnern« (V. 26).
Am ›fünfzigsten Tag‹ wird ursprünglich die Osterzeit festlich abgeschlossen. Erst mit dem Ende des 4. Jh. gewinnt Pfingsten mehr und mehr den Charakter eines eigenständigen Festes. Später wird es mit einer eigenen Festwoche (Festoktav) ausgestattet, eine Entscheidung, die die katholische Kirche in ihrer jüngsten Kalenderreform wieder zurückgenommen hat.
Pfingstwoche
Das Ev. Gottesdienstbuch hält - indem es für den Pfingstmontag und die Pfingstwoche ein eigenes Formular anbietet - in gewisser Weise an der alten Pfingstoktav fest. Die Osterzeit verlängert sich dadurch gleichsam um eine Woche und endet erst mit dem Sonnabend vor Trinitatis. Im Evangelium geht es am Pfingstmontag buchstäblich um die ›Begründung‹ der Kirche: »Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen« (Mt 16,13-19). Einen notwendigen Kontrapunkt hierzu setzt die Epistel, wenn sie von den verschiedenen Gaben, Ämtern und Kräften spricht, in denen der eine Geist wirkt, der die Kirche begründet, bewegt und erhält (1 Kor 12,4-11). Mit der Geschichte vom Turmbau zu Babel (1 Mose11,1-9) nimmt die alttestamentliche Lesung noch einmal auf das pfingstliche ›Sprachenwunder‹ Bezug. Die liturgische Farbe am Pfingstfest und in der Pfingstwoche ist rot.
Trinitatis
Am Sonntag nach Pfingsten begeht die evangelische und katholische Christenheit den Tag der Heiligen Dreifaltigkeit (Trinitatis ist Genitiv von lat. trinitas, in dem sich das Zahlwort drei und lat unitas = Einheit verbirgt). Der Tag gehört zur Gruppe der Ideenfeste, die keinem konkreten heilsgeschichtlichen Ereignis zugeordnet sind, sondern ein bestimmtes Thema des christlichen Glaubens zum Gegenstand haben. Das Bedürfnis, das Glaubensgeheimnis der Dreieinigkeit Gottes zu feiern, reicht bis ins Altertum zurück. Es stand in engem Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen um die Gottheit Christi und der Abwehr des Arianismus. Ursprungsort der liturgischen Dreifaltigkeitsfrömmigkeit und eines eigenen Festes waren vermutlich benediktinische Klöster. Im Jahre 1334 wurde das Fest von Papst Johannes XII. für die ganze Kirche verbindlich eingeführt und später auch von den Reformatoren beibehalten. Durch seine jetzige Stellung im Kirchenjahr kann es als thematische Bündelung jener heilsgeschichtlichen Ereignisse verstanden werden, die Gegenstand der großen Feste und Festzeiten des Kirchenjahres sind. Es setzt gleichsam den dogmatischen Schlusspunkt unter Weihnachten (Werk des Vaters), Ostern (Werk des Sohnes) und Pfingsten (Werk des Geistes).
Die Sonntage nach Trinitatis
Mit dem 1. Sonntag nach Trinitatis beginnt die lange Reihe der Sonntage nach Trinitatis. Kalendarisch hängen sie vom Ostertermin ab, inhaltlich entfalten sie das Evangelium auf vielfältige, durchaus unterschiedliche Weise. Die liturgische Farbe ist grün. Die Rede von der ›festlosen Zeit‹ des Kirchenjahres verkennt freilich, dass jeder Sonntag ein ›kleines Osterfest‹ ist und das Geschenk neuen, österlichen Lebens das Generalthema bildet, von dem her die anderen Glaubens- und Lebensthemen überhaupt erst sinnvoll behandelt werden können.
Erntedanktag
Erntedanktag im Herbst - traditionell am Sonntag nach Michaelis (29. September) oder am ersten Sonntag im Oktober begangen - ist einer der wenigen Anlässe, bei denen das Naturjahr unmittelbar in das Kirchenjahr hineinreicht. Die reformatorischen Kirchenordnungen hatten zunächst unterschiedliche Bestimmungen hinsichtlich des Termins getroffen: Manche verbanden den Dank für die Ernte mit Michaelis, andere legten ihn auf den Bartholomäustag (24. August), auf den Sonntag nach Ägidii (1. September) oder nach Martini (11. November).
Brich dem Hungrigen dein Brot: Die alttestamentliche Lesung aus Jes 58,7-12 stellt den Erntedanktag unter den Gedanken des Teilens. Dabei geht es nicht nur um Brot, sondern auch um Obdach, Kleidung, Gerechtigkeit, Verantwortung für andere Menschen schlechthin. Groß ist die Verheißung, die mit solchem Teilen verbunden ist: »Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt.« Es macht deshalb Sinn, das Evangelium auf den Erntedanktag (Mt 6,25-34: Vom falschen und rechten Sorgen) im Kontext dieser Lesung auszulegen: Solches Teilen der notwendigen Lebens-Mittel im Horizont des Gottesreiches und seiner Gerechtigkeit befreit von aller bangen, selbstbezogenen, engen und ängstigenden Sorge um den »morgigen Tag«.
Wer das Evangelium vom ›reichen Kornbauern‹ (Lk 12,[13-14]15-21) an diesem Tag liest, betont die Momente der Buße und der endzeitlichen Erwartung, die auf den ersten Blick weniger zu der fröhlichen Stimmung des Erntedanktages zu stimmen scheinen. Doch darf nicht übersehen werden, dass auch die alttestamentliche Lesung im Grunde eine Art Buß- bzw. Umkehrpredigt darstellt.
Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres
Wann kommt das Reich Gottes? Geheimnisvoll ist die Antwort, die Jesus auf diese Frage gibt (Evangelium Lk 17,20-24[25-30]): Sein Kommen lässt sich nicht »beobachten« - denn es ist (schon?) »mitten unter euch«. Viele Exegeten interpretieren das so, dass sich im Wirken Jesu bereits hier und jetzt die Nähe des Gottesreiches zeigt, dass es also ›in ihm‹ bereits im Kommen ist: »Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag des Heils« (Wochenspruch 2 Kor 6,2b). Dass dies verborgen ist, dass das Gottesreich in seiner offenbaren, vollendeten Gestalt erst noch erscheinen wird, daran lässt das Evangelium freilich gleichfalls keinen Zweifel. Die anderen Lesetexte des Sonntags stellen stärker individuelle Aspekte in den Mittelpunkt: Die alttestamentliche Lesung aus Hiob 14,16 vergleicht das menschliche Leben mit einer ›Blume‹ und einem ›Schatten‹ und weist so auf seine Endlichkeit und Vergänglichkeit hin.
Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres
Wann haben wir dich hungrig gesehen? Evangelium des Sonntags ist das gewaltige Gleichnis ›vom Weltgericht‹ (Mt 25,31-46), das in dem Wort gipfelt: »Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.« Die Epistel Röm 8,18-23(24-25) artikuliert die Sehnsucht der ganzen Schöpfung nach Erlösung und stellt damit die Hoffnung auf das Kommen des Gottesreiches in einen universellen, geradezu kosmischen Horizont: »...denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes.«
Wochenlied singt man die Umdichtung der alten Sequenz aus den Messen für die Verstorbenen Dies irae, dies illa: »Es ist gewisslich an der Zeit, dass Gottes Sohn wird kommen« (EG 149).
Das Tagesgebet bringt die Hoffnung zur Sprache, wie sie von Paulus in der Epistel angesprochen werden: »...in Jesus Christus hast du Frieden gestiftet. Wir sehnen uns nach diesem Frieden, nach Gerechtigkeit und erfüllter Gemeinschaft.« Mag sein, dass es dabei auch den Volkstrauertag im Blick hat, der in Deutschland an diesem Sonntag begangen wird.
Der Vorletzte Sonntag kann im Rahmen der Friedensdekade auch als ›Friedenssonntag‹ begangen werden.
Buß- und Bettag
Buß- und Bettage wurden früher häufig aus aktuellem Anlass ausgerufen. Sie trugen ursprünglich öffentlichen Charakter: Die gesamte Bevölkerung wurde angesichts von Notständen und Gefahren zu Buße und Gebet aufgefordert. Dieser Charakter ging allmählich weithin verloren und machte einem stärker auf den Einzelnen bezogenen Verständnis von Buße und Bitte Platz. In verschiedenen Anläufen (1853, 1878, 1893) einigten sich die evangelischen Landeskirchen Deutschlands schließlich auf die Einführung eines allgemeinen Buß- und Bettages am Mittwoch vor dem letzten Trinitatissonntag.
Die liturgische Farbe am Buß- und Bettag ist violett. Vielleicht bringt er doch noch Frucht: Das Gleichnis vom Feigenbaum (im Evangelium Lk 13,81-5]6-9) enthält einen Rest von Hoffnung für das undankbare Gewächs. Wie das gemeint ist, macht der erste Teil der Evangelienlesung deutlich, und deshalb sollte man ihn keinesfalls auslassen: »Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen.« Ähnlich formuliert es Paulus in der Epistel (Röm 2,1-11), in der er im übrigen sehr hart mit den »verstockten und unbußfertigen Herzen« ins Gericht geht: »Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet?«
Letzter Sonntag des Kirchenjahres / Ewigkeitssonntag
Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen: Die Epistel Offb 21,1-7 ist ein sehr starker, bildmächtiger Text. Endlich ist alles Leid, aller Schmerz, alle Trennung vorbei: Das neue Jerusalem senkt sich auf die Erde, Gott schlägt seine Hütte bei den Menschen auf. Glühender, gewaltiger, jubelnder lässt sich das Ende kaum schildern.
Das Wochenlied EG 147 nimmt das Bild vom ›neuen Jerusalem‹ auf: »Von zwölf Perlen sind die Tore an deiner Stadt...« und verbindet es mit dem Jungfrauen-Gleichnis, das als Evangelium gelesen wird (Mt 25,1-13). Unter all den Endzeit-Jubel mischen sich hier wieder ernste, mahnende Töne: Ein großes Fest ist angesagt - es wäre töricht, es aus Bequemlichkeit, Trägheit, Ignoranz, Eigensinn, Kurzsicht zu verpassen. Der Wochenspruch aus Lk 12,35 fasst dies bildhaft in die Mahnung: »Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen.«
Nach dem Willen des Ev. Gottesdienstbuches soll dort, wo es üblich ist, das Gedächtnis der Entschlafenen in einem eigenen Früh-, Predigt- oder Vespergottesdienst begangen werden, es soll aber die Texte des Ewigkeitssonntags keineswegs verdrängen. Dass diese sehr wohl geeignet sind, auch die Erwartungen, Klagen, Ängste, Hoffnungen, Fragen aufzunehmen, die sich mit dem ›Totensonntag‹ verbinden, dürfte deutlich geworden sein. Den hatte König Friedrich Wilhelm III. von Preußen durch Kabinettsordre vom 17. 11. 1816 zum Gedenken an die in den Befreiungskriegen Gefallenen eingeführt. Von anderen Landeskirchen übernommen, gewann das ›Totenfest‹ zum Abschluss des Kirchenjahres - in gewisser Weise evangelisches Gegenstück zur Feier von ›Allerseelen‹ (2. 11.) in der katholischen Kirche - rasch große Popularität. In ihm kommt ein tiefes menschliches Bedürfnis zum Ausdruck, das bei der Begehung des ›Ewigkeitssonntages‹ keineswegs vernachlässigt werden darf.
Textbasis: Prof. Karl-Heinrich Bieritz